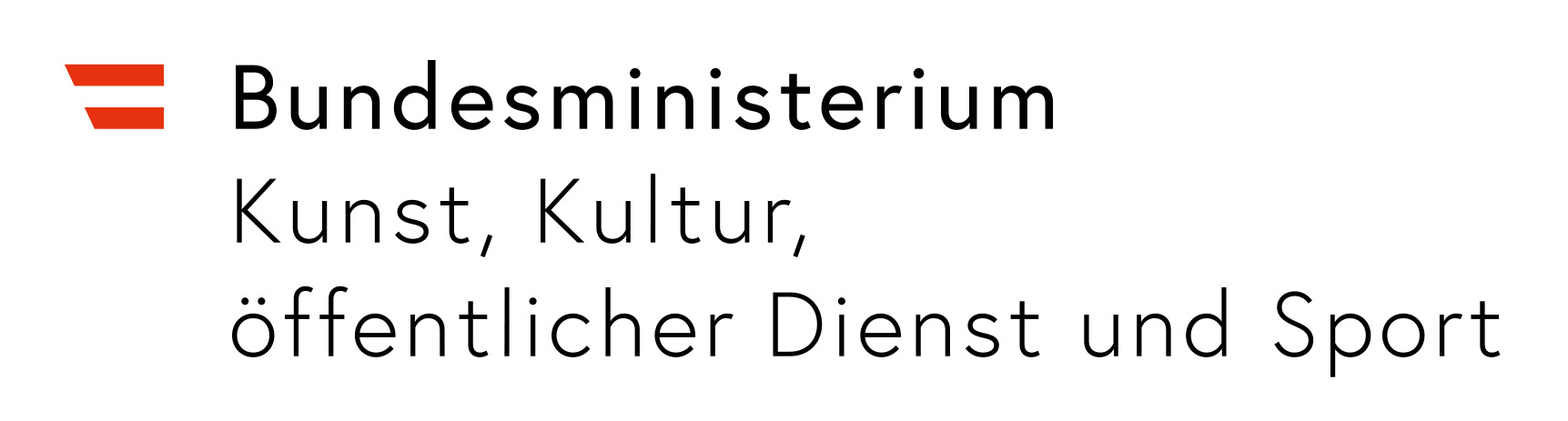Misstraue der Idylle!
24.06. – 24.07.2022 / Galerie 2
Eröffnung mit Künstler*innengespräch Fr 24.06., 17 Uhr
Michaela Bruckmüller, Jungeun Lee, Sophie Tiller, Hans Wetzelsdorfer
24.6.2022 18 Uhr Ausstellungseröffnung: Zur Ausstellung spricht Peter Zawrel
25 6. – 6.8.2022 Ausstellung: Schloss Wolkersdorf, Galerie 2, Samstag, Sonntag 14 – 18 Uhr und nach persönlicher Vereinbarung
Michaela Bruckmüller, Jungeun Lee, Sophie Tiller, Hans Wetzelsdorfer

Der Parasit © Sophie Tiller
Die Ausstellung versammelt Arbeiten von Künstler*innen, die sich mit der Darstellung von botanischen Systemen und Strukturen beschäftigen. Ein verbindendes Element ist eine intensive Auseinandersetzung mit der Vergänglichkeit von organischen Formen.
Familiensysteme, Pflanzenfamilien, Wurzeln, Grenzbereiche, Familienfotos – Gruppierungen schaffen Ordnung, Ordnung schafft Vertrauen. In diesem Kontext siedeln sich die Arbeiten an. Sie stellen die Frage, inwieweit die Katalogisierung der Natur (ein Wissensprojekt, dessen „Wurzeln“ weit in die Vergangenheit zurückreichen) nicht per se Ausdruck einer menschlichen Haltung ist, die den natürlichen Zugang zur Welt bereits verloren hat.
Eröffnungsrede von Peter Zawrel zur Ausstellung „Misstraue der Idylle“, FLUSS Wolkersdorf 24. Juni 2022
Fotos: Michael Michlmayr
Was ist Idylle?
„Die Sinnlichkeit eines Chypre und die innige Facette des weißen Moschus verbinden sich mit einem Blumenbouquet, das als klassisches Symbol für eine Liebeserklärung steht. So verleiht Thierry Wasser einem romantischen und lustvollen Begriff von Idylle Ausdruck.“ Thierry Wasser, der Parfumeur des Hauses GUERLAIN, hat für das Parfum „Idylle“ „sorgsam die besten bulgarischen Rosen ausgewählt. Sie werden in den Tälern Bulgariens bei Sonnenaufgang von Hand gepflückt. Der daraus komponierte Verschnitt verströmt einen einzigartigen, fruchtigen Duft mit Anklängen von Himbeere und Litschi.“ Den Gegenentwurf zum Parfum finden wir bei André Heller:
„Misstraue der Idylle / Sie ist ein Mörderstück – / Schlägst du dich auf ihre Seite / Schlägt sie dich zurück!“
Bei Sonnenaufgang Rosen pflücken – eine klassische bukolische Szene an einem locus amouenus, einem lieblichen Ort, in den Tälern Bulgariens, da fehlen noch ein paar Hirten, die sich um eine Schäferin gruppieren, und die arkadische Szene im Sinne Vergils, gemalt etwa von Nicolas Poussin im 17. Jahrhundert, ist vollendet. „Et in Arcadia Ego“ – auch ich war in Arkadien, lautet das Memento Mori, das uns an den Verlust einer paradiesischen Einfachheit gemahnt, die wir uns als Sehnsuchtsort unserer komplizierten und aus den Rudern laufenden Wirklichkeit imaginieren.
André Hellers Idylle dagegen repliziert auf eine der folgenreichsten Idyllen der deutschen Literatur, Goethes Versepos „Hermann und Dorothea“ von 1796, eine Reaktion auf die Revolutionskriege, an denen Goethe ja teilgenommen hat („Kampagne in Frankreich“, 1792). Die Heldin Dorothea gelangt mit einem linksrheinischen deutschen Flüchtlingstreck in eine rechtsrheinische deutsche Kleinstadt, wo der junge Flüchtlingshelfer Hermann sie im Lager entdeckt. Der Rest ist Literaturgeschichte.

Gegenwärtig taumeln wir von einer Krise in die nächste, der Boden wird uns scheinbar täglich unter den Füssen weggezogen, von einem Virus, einem russischen Despoten, dem Klimakollaps oder der Vorstellung, dass wir im nächsten Winter bei abgedrehtem Gashahn nicht einmal den Baum vor dem Fenster verheizen können, so wie das unsere Großeltern im Nachkriegswinter 1946/1947 getan haben, weil wir die luftverpestenden Dauerbrandöfen in unseren Städten schon lange demontiert haben.
Dabei übersehen wir geflissentlich, dass es weltweit mehr Menschen gibt, als in Europa leben, denen gar kein Boden unter den Füßen weggezogen werden kann, weil sie da noch nie einen hatten. Weil sie immer schon aus dem Nest gefallen waren, das Hans Wetzelsdorfer zum Thema eines seiner beiden Ausstellungsbeiträge gemacht hat. Im hiesigen Kulturkreis können wir es uns aber noch leisten, in die Idylle zu flüchten, und sei es eine vermeintliche. Schon mein ganzes Leben lang sind die Berge und die Natur mein bevorzugter Aufenthaltsort, aber noch nie bin ich dort, und sogar abseits der Ameisenstraßen, so vielen Menschen begegnet, wie in den letzten beiden Jahren. Am signifikantesten ist ihr ungeeignetes Schuhwerk, das ihnen die Idylle unerwartet verleiden könnte.
Andere, die so glücklich sind, über einen eingezäunten Privatraum zu verfügen, ziehen sich dorthin zurück. Wer sich die 125 Euro für 75 Milliliter Idylle von Guerlain nicht leisten kann, investiert in Balkonpflanzen, Gemüsebeete oder Gartenbiotope oder leistet sich mangels Reisemöglichkeiten um das Urlaubsgeld einen Swimmingpool, oft gut versteckt hinter mannshohen Hecken und umgeben von pflanzenlosen Steingärten. Dass es aber auch andere Gartenutopien gibt, zeigt die Ausstellung von Charlotte Gohs im anderen Stockwerk. Ungeplant und ohne Absicht entspinnt sich zwischen den beiden gleichzeitigen Ausstellungen ein vielstimmiger Dialog, orchestriert von den künstlerischen Objekten Alfred Hruschkas in der Ausstellung von Charlotte Gohs und im verbindenden Stiegenhaus, die uns an das gemahnen, was vielleicht in Zukunft von unseren Idyllen übrig geblieben sein wird.
Jede Idylle ist künstlich. Vor kurzem habe ich in einem Landgasthaus nach dem Blumensträußchen gegriffen, das am Tisch stand, um daran zu riechen. Das war aber geruchlos, weil aus Plastik, doch täuschend echt. Wer nicht täglich Pflanzen gießen will, muss sie stattdessen halt abstauben. Sophie Tiller spielt in ihren Fotografien mit dem Titel „Better than Nature“ mit den irritierenden Transformationsprozessen zwischen Natur und ihren Imitaten. Was wir in diesen Bildern sehen, ist alles vom Menschen gemacht, auch wenn es nicht so aussieht – die Kunstpflanze aus Plastik, die Kulturpflanze aus der Zuchtanstalt und die Stabheuschrecke aus dem Terrarium.

Genauso vom Menschen gemacht ist inzwischen fast die gesamte Landschaft, durch die wir uns bewegen, Ergebnis des jahrtausendelangen Prozesses einer hochkomplexen Kultivierung, die zum Beispiel auf vollständig bewaldeten Bergen wunderbare Wiesen entstehen ließ, die aber alle wieder verschwinden werden, wenn es keine Almwirtschaft mehr gibt. Die idyllischen Ansichtskartenmotive der Tourismusindustrie werden dann nur noch historischen Wert haben. Sophie Tillers Werk „Der Parasit“ veranschaulicht, was es heißt, wenn die Natur sich die Kultur zurückholt. Die ins Naturkundebuch gepflanzte Kapuzinerkresse leistet die Pionierarbeit für die nachkommende Pflanzengesellschaft. Irgendwann wird das Buch – als Naturkundebuch die Materialisierung einer geistigen Leistung, eines Nachdenkens über die Natur – in der vom Menschen injizierten Natur aufgegangen sein.

Auch die Waldohreule, die uns am Beginn der Ausstellung begrüßt, stammt von Menschenhand. Es gibt keine Präparation ohne Interpretation des Präparierten. Taxidermisten, die Präparatoren von Wirbeltieren, verfügen über eine ähnliche Ausbildung wie Bildhauer, sonst könnten sie den Grundkörper gar nicht herstellen, über den das Präparat gezogen wird. Indem Michaela Bruckmüller die Fotografie der präparierten Eule auf ein Teppichgewebe druckt, verdoppelt sie die Künstlichkeit. Da die Präparation von geschützten Tieren inzwischen verboten ist, könnte man sich als nächsten Schritt die Verwendung des Wandteppichs zur Ausstattung einer Jagdstube vorstellen und diese wiederum fotografisch dokumentieren – womit sich die Endlosspirale eines Alptraumes eröffnen würde, an deren Ende wir in einem Film von Ulrich Seidl aufwachen. Im Kitsch kommt die Idylle zu sich selbst.

Am Ende der Ausstellung stoßen wir dann auf eine ganze Menagerie von Präparaten in der Arbeit „Selektion“ von Sophie Tiller. Sie zeigt Personen mit dem Präparat, das sie sich aus einer Sammlung ausgewählt haben. Das aufliegende Buch dokumentiert, dass diese Personen bereit waren, ihre Identität und ihren Beruf preiszugeben und ihre Auswahl zu begründen. Das finde ich beachtlich. Es erleichtert mir, zu gestehen, dass ich als Kind einen „ausgestopften“, wie es damals hieß, Waldkauz besessen habe, eine verlegene Reaktion meiner Eltern auf die Empfehlung der Kinderpsychologin, mir einen Vogel als Haustier zu genehmigen, der als lebendiger Wellensittich erst ein Jahr später in den Haushalt einzog. Der Waldkauz war mir den Rest meines Lebens peinlich – bis ich die Geständnisse in „Selektion“ entdeckt habe. Fetische haben ihre Berechtigung. Mit ihren unterschiedlichen bildlichen und textlichen Ebenen schafft Sophie Tiller eine soziale Plastik, der nur das olefaktorische Element fehlt, das Tierpräparaten – im Gegensatz zu Plastikblumen – eignet. Präparaten, die von der Natur selbst geschaffen wurden, widmet sich Hans Wetzelsdorfer. Behausungen, die sich Tiere bauen, gehören zu den komplexesten Gebilden, die es in der Natur überhaupt gibt. Wer jemals das Nest einer Beutelmeise entdeckt hat, wird sicherlich aus dem Staunen nicht herausgekommen sein. Wir vermenschlichen solche genetisch kodierten Leistungen gerne, indem wir sie als „kunstvoll“ bezeichnen. Aber das Tier kann nicht anders als es tut, es folgt einem aus der Evolution abgeleiteten Bauplan. Auch Menschen bauen sich ihre „Nester“, und gerne übertragen wir unsere Metaphern von Gemütlichkeit und Geborgenheit zurück auf die wirklichen Nester. Wie uns die fotografischen Aufsichten aber zeigen, besteht deren Inhalt zuletzt aus Scheiße, Federn, Essensresten und anderem, das wir nicht kennen wollen, denn Vogelnester sind Aufzuchtstätten, in denen auch Mord und Totschlag zum Alltag gehört, Verhungern und Ausgestoßen werden. Im Internet gibt es inzwischen genügend Videomaterial von versteckten Mikrokameras, die uns das echte Leben in den Nestern zeigen. Es gibt menschliche „Nester“, in denen es nicht anders zugeht.


Anders verhält es sich mit den Kinderstuben von Insekten wie zum Beispiel der Gallwespen, die uns Wetzelsdorfer hier zeigt. Wir können nicht hineinblicken. Aber wir wissen, dass es sich um eine Art Tumor der angestochenen Pflanze handelt, von der sich die Larven ernähren. Und wir wissen, dass diese merkwürdigen Gebilde noch ein anderes Geheimnis bergen, dessen Entdeckung durch den Menschen mir immer schon rätselhaft erschien. Denn seit der Spätantike ist der in den Pflanzengallen enthaltene Gerbstoff wichtigste Grundlage für die Herstellung von Eisengallustinte, die auch heute noch aus einigen exklusiven Füllhaltern aufs Papier fließt. Dummerweise führt diese Tinte aber auch langfristig zum Tintenfraß, also der Vernichtung des beschriebenen Papiers, genau dort, wo es beschrieben wurde, was allen Liebhabern von Johann Sebastian Bach bekannt sein dürfte. Nur Pergament kann die Gallustinte nichts anhaben. Andernfalls wäre der größere Teil von Überlieferungen der uns bekannten Geschichte, Literatur und Kultur vernichtet. Nehmen Sie diesen Gedanken als meinen eigenen kleinen Beitrag zu dieser Ausstellung, die zwischen Werden und Vergehen von Natur, Kultur und unseren Bildern davon changiert.
Eine besondere Rolle in unseren Vorstellungen eines idyllischen Ortes spielt Wasser, egal ob es vor sich hinplätschert, seine Oberfläche im Sonnenlicht flirrt und spiegelt oder sich das Vieh und die Hirten in der arkadischen Landschaft daran laben. Wir wissen aber auch schon seit der Antike, dass nichts trügerischer ist als das Wasser. Antike Nymphen, die dem Mittelalter entstammende Undine und Shakespeares Ophelia – auf dem schweizerischen Internetportal Watson findet sich dazu die kleine und sehr empfehlenswerte Kulturgeschichte der Wasserleiche.


Michaela Bruckmüller hat sich von John Everett Millais berühmten romantischen Gemälde von 1852 zu ihrer Arbeit „Ophelialga“ inspirieren lassen. Sie legt beschichtete Fotografien von Giftpflanzen in Teichwasser und lässt die darin enthaltenen Bakterien ihre Arbeit tun, was Sie hier vor Ort beobachten können. Wie Bruckmüller selbst sehr treffend formuliert: Ein schmaler Grat, an dem das Schöne und das Abgrundtiefe dicht beisammen liegen. Dass ausgerechnet die wenigen tödlich giftigen Pflanzen, die in unseren Breiten wachsen, zu den schönsten gehören, ist der Natur nicht anzulasten, sondern unserem Schönheitsbegriff. Das Maiglöckchen gehört dazu, seinem idyllischen Anblick ist in der Tat zu misstrauen, denn eine Handvoll Blätter genügt, um gleich mehrere Personen ins Jenseits zu befördern, und manche, so wie ich, sind schon benommen, wenn sie nur dran riechen. Dass ausgerechnet der Maiglöckchenstrauß zu einem Zeichen des Bräutigams wurde, dürfte auf die Häufung von Hochzeiten im Wonnemonat Mai zurückzuführen sein, aber zum Glück sind die meistens eh aus Plastik.

Ganz dem Wasser hat sich Jungeun Lee in ihrem Biotop-Projekt gewidmet. Die junge, in Karlsruhe studierende Koreanerin füllt seit 2019 in verschiedenen Ländern Wasser aus der Natur, in diesem Fall aus dem Schlossteich, in Gläser und überlässt es seinem Schicksal, das immer ein anderes ist. In der Projektion sehen Sie, was sich in dem Wasser so alles abspielt, und was Sie hören, ist die Transformation der Bewegung der Lebewesen im Wasser auf eine akustische Ebene.. Im geschlossenen Raum des Glasbehälters entsteht ein sich selbst erhaltendes, lebendiges Ecosystem, dessen einzige Energiequelle das Sonnenlicht ist. Lees Projekt lässt sich auch als Metapher der gegenwärtigen pandemiebedingten gesellschaftlichen Situation lesen. Wenn wir die menschliche Gesellschaft als Ecosystem begreifen wollen, müssen wir über das unmittelbar greifbare und sichtbare hinausblicken. Wissenschaft und Technologie und das Management unseres Wissens alleine werden dafür nicht ausreichen. Jungeun Lee bringt selbst auf den Punkt, worum es in dieser Ausstellung und in der Arbeit von immer mehr Künstlerinnen und Künstlern gegenwärtig geht:
“I hope that this project will be an opportunity to look into our lives changed by the current era and to think about the relationship between humans and nature through the language of art.”