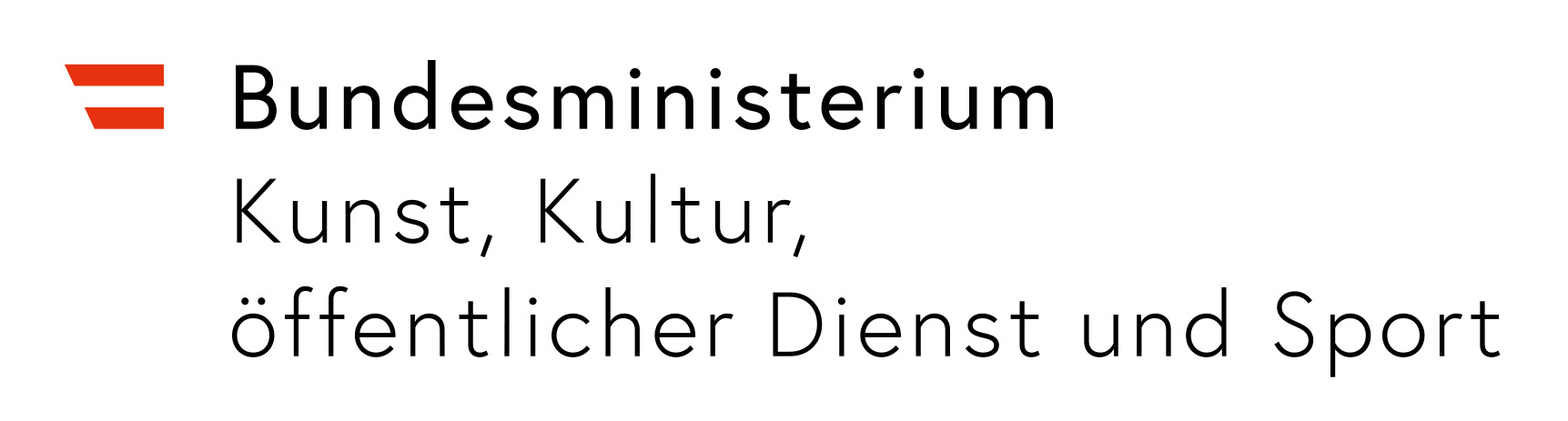Open Culture: Warum wir eine offene Kultur brauchen
Günther Friesinger
Das Schlagwort von der „Open Culture“ umgreift eine Vielzahl heterogener Konzepte, die sich nicht ausschließlich auf das Netz bzw. die digitale Kultur reduzieren lassen: die Open-Source-Bewegung, der Open-Access-Gedanke, die Diskussion um so genannte „Commons“, der Kampf gegen regressive Copyrights, „Wikileaks“, die Hacker_innen-Szene, bestimmte künstlerische Interventionen und ästhetische Praxen (etwa die der DIY-Kultur), Peer-Production, Blogs und Desktop Publishing.
Aber auch der Widerstand gegen die Standardisierung und Entdifferenzierung von Saatgut in der EU, auf die vor allem der Monsanto-Konzern hinarbeitet, richtet sich gegen kulturelle Schließungen, nämlich gegen eine künstliche Verknappung der Artenvielfalt. „Open Culture“ muss also nicht auf „digitale“ Gegenstände beschränkt bleiben, obwohl auch in diesem Fall das Netz eine Rolle spielt, und zwar als jener Ort, von dem aus am effektivsten gegen das neue EU-Saatgutrecht vorgegangen werden kann, u. a. durch Onlinekampagnen, die via Blogs, Social Media-Plattformen, Mail oder Twitter verbreitet werden.
All diese Kämpfe formulieren in der einen oder anderen Weise den Anspruch auf informationelle Barrierefreiheit und auf eine demokratische Kultur mit niedrigschwelligen Zugangsvoraussetzungen. Der freie Zugang zu Technologie, Kultur und Information wird dabei als Alternative zum kapitalistischen Verwertungsprinzip entworfen. Von der offenen Kultur könnte eine freie Gesellschaft freier Subjekte ihren Ausgang nehmen, auch wenn über diese bisweilen sehr unterschiedliche Vorstellungen innerhalb dieser diffusen multiplen Bewegung existieren: vom technokratischen Liberalismus bis hin zum „Cyberkommunismus“.
Gerade in ihrer Widersprüchlichkeit formieren die Konzepte, Positionen, Strategien und Strukturen der offenen Kulturszene ein Feld, das um Praxen der Öffnung und der Partizipation herum entstanden ist – ein Beziehungsgeflecht, das sich immer weiter verzweigt und dabei in sich selbst doch auch offen bleibt: durchlässig, wie es Netzwerke nun einmal sind. Die offene Kultur wird ihren eigenen Ansprüchen zumindest insofern gerecht, dass sie zur Teilnahme auffordert und die Zugänge zu ihr offen hält. Sie stellt auf Inklusion ab, nicht auf Exklusivität. Und sie hat bislang noch keine geschlossene Formen oder Begrenzungen ausgebildet. Noch wächst sie und verändert sich dabei immer wieder. Sie befindet sich im Werden – mit offenem Ausgang. Offene Kultur besitzt kein Zentrum. Sie entspricht vielleicht dem, was unter dem Begriff der „Multitude“ verhandelt wird: einem Geflecht aus „Singularitäten, die gemeinsam handeln“, wie es bei Michael Hardt und Antonio Negri heißt.
Anders als klassische Alternativkulturen hat „Open Culture“ nicht die Absicht, einen bestimmten Raum einzunehmen oder eine Nische zu besetzen, die dann als Gegenentwurf der falschen oder entfremdeten Form der bürgerlichen Kultur entgegentritt. „Open Culture“ möchte diese vielmehr infiltrieren, um sie von innen heraus zu verändern. Und sie möchte uns in die Lage versetzen, ihre Werkzeuge und Kanäle besser zu verstehen und selbstbestimmt zu handhaben. Dabei ist „Open Culture“ keineswegs eine Erfindung des digitalen Zeitalters. Die Idee, die kulturellen Produktionsmittel umzuverteilen bzw. allen gleichermaßen zugänglich zu machen, taucht in der bürgerlichen Kulturgeschichte immer wieder auf, zum Beispiel Ende der 1970er innerhalb der „Do it yourself“-Bewegung des Punk und Postpunk. Unabhängig voneinander brachten damals Bands wie Scritti Politi oder die Desperate Bicycles selbstproduzierte Schallplatten in Umlauf, auf deren Hüllen die Produktionskosten genau aufgeschlüsselt waren. Dazu gaben sie Tipps und Adressen günstiger Presswerke. „It was easy/It was cheap/Go on, do it“, heißt es im Refrain von „The medium was the tedium”, einem programmatischen Stück der Desperate Bicycles. Viele der mehreren hundert Gruppen, die wenig später ihrem Beispiel folgten, verwiesen dabei ausdrücklich auf diese Platten: als Inspirations- und als Informationsquelle. Der DIY-Bewegung ging es vor allem darum, kulturelle Produktion zu dezentralisieren und kulturelle Hegemonien zu durchbrechen. Sich Produktionsmittel auf diese Weise anzueignen, war also immer zugleich eine symbolische Intervention in kulturelle Besitzverhältnisse und eine praktische Anregung, selbst produktiv zu werden.
Die Sehnsucht nach „geöffneter Kultur“ ist also im Prinzip ebenso alt wie die Idee des Privateigentums an Medien und Technologie, die mit der bürgerlichen Gesellschaft entstand und in Patent- und Urheberrechtstiteln verankert wurde. Allerdings bietet erst die digitale Gegenwart technische Möglichkeiten um sie umfassend zu realisieren. Waren die selbstproduzierten Singles des englischen Postpunk noch ein klassisches Nischenprodukt, das kaum Chancen auf Breitenwirkung und Hitparadenerfolg hatte, ist Digitalisierung längst in jedem Haushalt angekommen. Die Einführung des Computers als gesellschaftliches Leitmedium – zumindest innerhalb des westlichen Kulturraums – und die Verflechtung privater Rechnerkapazitäten zu einem weltumspannenden Netzwerk und einer globalen Austauschplattform verändert die gesamte kulturelle Praxis: Produktion, Distribution und Rezeption.
Denn erstens befinden sich die kulturellen Artefakte auf dem Weg von der feststofflichen Form, die über die Jahrhunderte hinweg ihre Existenz- und Erscheinungsweise war (als Buch, als Tonträger oder als bildkünstlerisches Werk), in die digitale Abstraktion (als Datenformat). Dies hat Folgen für das Kunstwerk selbst, für die ihm zugrunde liegenden Werk- und Kunstbegriffe, für seine Wahrnehmung, für seine Verfügbarkeit und schließlich auch für jene kulturellen Praxen, die es konstituiert.
Damit verändert sich zweitens aber auch die Kultursphäre als Raum spezifischer Ex- und Inklusion. Die althergebrachte Form der Kulturgüter war immer an die konkrete Objektgestalt verwiesen, in der diese erschienen. Als Objekte konnten sie in materielle Besitzverhältnisse überführt und zum Beispiel in privaten Sammlungen der Allgemeinheit entzogen werden. Wer sich unerlaubterweise Zugang zu ihnen verschafft, um etwa bestimmte Originale einmal selbst in Augenschein zu nehmen, übertritt Gesetze, die für Alte Meister in exakt derselben Weise gelten wie für alle anderen Wertgegenstände. Beides ist juristisch Gegenstand der Privatsphäre, die wiederum ein schützenswertes Rechtsgut darstellt.
Die Digitalisierung verwandelt also die Kultur in vielfacher Weise, vor allem aber hinsichtlich ihrer Verfügbarkeit und der Partizipationsmöglichkeiten, die sie bietet. Weil das digitale Zeitalter also im Begriff steht, die gesamte kulturelle Sphäre zu öffnen, müssen wir uns die Frage stellen, inwiefern dies denn überhaupt wünschenswert ist und, wenn ja, wie wir den Zugang offen halten können. Wie können wir die Emanzipationsmöglichkeiten, die die digitalisierte Kultur erstmals auf breiter Front bereitstellt, verteidigen und entfalten?
Die alten kulturellen Besitzobjekte stellten auf eine bestimmte Rezeptionspraxis ab, die sich im privaten Raum vollzog, in dem sich der persönliche Besitz an Kulturgütern unter Ausschluss der Öffentlichkeit genießen ließ. Rezeptionspraxis und Objektform der Kultur waren eng miteinander verbacken – und sind es bisweilen noch immer: Die bürgerliche Hausordnung räumt der privaten Inszenierung entsprechender Sammlungen (von Büchern, Schallplatten oder Bildkunstwerken) eine besondere Bedeutung ein. Im Zugriff auf Kultur erzeugt sich jener Klassenhabitus, der zur spezifischen Warenform des bürgerlichen Subjekts gehört. Die gut sortierte Bibliothek ist Ausweis von Belesenheit und bestimmter kultureller Präferenzen. In ihr zeigt sich der besondere Wert, den wir der Kultur beimessen. Also platzieren wir sie gut sichtbar im Wohnzimmer statt sie so zu verstecken, wie es digitale Medien mit den auf ihnen gespeicherten Daten und Programmen tun. Das iPad unseres Gegenübers im Zug verrät uns nämlich niemals, was darauf gerade gelesen wird: „Schund“ oder Dostojewski, Geschäftstabellen oder Fußballergebnisse … Seine Rückseite bleibt – anders als der Buchrücken – stumm.
Digitale Speichermedien implizieren also in einer gewissen Weise bereits ihrer Form nach einen Bruch mit der tradierten Distinktionspraxis des (bildungs-) bürgerlichen Subjekts. Gegen dessen Selbstvergewisserung durch Plattenschrank oder Bibliothek setzen sie den Egalitarismus der Geräte. Soziokulturelle Hierarchien konstituieren diese nämlich allenfalls noch hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit und Aktualität, nicht mehr aber durch die auf ihnen abgespeicherten Inhalte. Zumindest wirken sie nicht mehr in der gleichen Weise Respekt einflößend wie ein gut gefülltes Bücherregal.
Digitale Kulturwarendistribution (wie Filesharing oder die Komplettüberspielung ganzer Film- und Musikarchive per Wechselfestplatte) überschreitet den Raum des Privaten, der ein zentrales Merkmal der bürgerlichen Subjektivität ist. Und sie sprengt die Besitzform auf, von der aus sich die klassische Kulturware bestimmte. Begriffe, wie etwa der von ihrer „Aura“, die ihre originäre und einmalige Gegenwart verströmen soll, verklären sie zum metaphysischen Ding, zu etwas Religiösem, dem wir eine merkwürdige Macht über unsere Sinne zugestehen. Mit derlei Andacht bricht Digitalisierung. Und sie löst kulturell hergestellte Rangordnungen auf, etwa wenn Musik kostenlos heruntergeladen werden kann, die bislang nur teuer und auf entsprechenden Nischenmärkten (mit ihren in Spezialwissen basierten Zugangsvoraussetzungen) zu haben war. Plötzlich steht alles tendenziell gleichberechtigt im Netz und kann – sobald wir von seiner Existenz wissen – dort problemlos gefunden und abgerufen werden. Kulturelle Privilegien werden dabei eingeebnet, Ausschlüsse rückgängig gemacht. Was bislang nur in Form seltener und teurerer Originale verfügbar war, ist nun frei zugänglich. Kunstwerke, für deren Augenscheinnahme wir oft weit entfernte Museen aufsuchen mussten, können wir betrachten, ohne das Haus zu verlassen. Das Netz scheint das ideale Medium zu sein, um die menschliche Kultur zu speichern, zu verschlagworten und zu verwalten.
Walter Benjamin hat das emanzipatorische Potential vervielfältigter Kultur bereits 1936 in seinem berühmten Aufsatz über „Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit“ beschrieben.
Reproduzierbarkeit wird oft schockhaft als Entzug bisher gültiger kultureller Wertesysteme erlebt: als Auraverlust der digitalen Kulturware gegenüber der analogen, etwa des mp3-Formats gegenüber der „wertigen“ Vinylschallplatte mit ihren sinnlichen Sonderqualitäten, oder des Buches gegenüber dem E-Book, was sich besonders prägnant an der Romantisierung alter Schwachstellen zeigt (Vinylgeknister, Geruch und Schwere des traditionellen Buches). Dies ist eine logische Folge der stark überhitzten und emotionalisierten Wahrnehmung von Kultur innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft. Kulturelle Kompetenz als bürgerliche Schlüsselqualifikation ist dabei immer an bestimmte Medientypen gebunden, und wo diese sich verändern, ist jene in Gefahr vom technischen Fortschritt überrollt zu werden.
Mithilfe der Digitalisierung schwindet nämlich nicht nur jene soziale Hierarchie, die sich im privaten Besitz kultureller Güter begründet, sondern ebenso die von Zentrum und Peripherie. Im Zeitalter allgemeiner Netzzugänge sind wir nicht länger gezwungen, uns mit dem kulturellen Angebot und Horizont unserer unmittelbaren Umgebung zu begnügen oder aufwändige und kostspielige Reisen an jene Orte zu unternehmen, an denen etwas stattfindet. Der kulturgeografische Vorteil des Zentrums wird damit zumindest partiell annulliert. Für Kulturproduzent_innen der Peripherie erhöht sich wiederum die Chance wahrgenommen zu werden, wie es das Beispiel des britischen Postpunk belegt: Bis Ende der 1970er mussten Bands nach London übersiedeln, wenn sie Platten produzieren und überregional bekannt werden wollten. Das führte dazu, dass der Rest des Landes popkulturell verödete. Erst mit dem Do-It-Yourself-Prinzip entstand auch in entlegenen Gegenden eine prosperierende Musiklandschaft.
In diesem Sinne war Technologiegeschichte immer auch eine der kulturellen Öffnung: Motorisierte Fortbewegungsmittel ließen Entfernungen schrumpfen; Verfahren der Bild- und Tonreproduktion vervielfältigten Kulturschätze und machten sie über große räumliche Distanzen verfügbar; Liveübertragungen via Satellit erlaubten es, Ereignissen auf der anderen Seite der Welt beizuwohnen etc. Jede neue Technologie enthält neue Möglichkeiten kultureller Partizipation, die aktiv oder passiv genutzt werden können. Die Digitalisierung hat all das nur beschleunigt. Sie ermöglichte jedoch nicht nur die Weiterentwicklung und Optimierung bereits bestehender Möglichkeiten, sondern markiert einen Quantensprung, von dem wir aktuell noch gar nicht abschätzen können, wohin er uns in den nächsten fünfzig Jahren führen wird.
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt müssen wir davon ausgehen, dass die Art und Weise, wie Kultur produziert und rezipiert wird, sich in nur wenigen Jahren radikal verändert haben wird. Verschwinden wird dabei vor allem die alte Ordnung von Produktion und Rezeption, die aktive und passive Rollen zuweist. Die digitalen Rezipient_innen der Gegenwart verfügen über vielfältige Mittel, selbst zu Produzent_innen zu werden. Sie brauchen dafür weder spezielles Werkzeug noch eine besondere Ausbildung, sondern allenfalls ein wenig Geschick und etwas Grundlagenwissen. Soundprogramme, mit denen sich z.B. fremde Musik remixen lässt, gehören zur Standardausrüstung der letzten Rechnergenerationen, und wo nicht, können sie jederzeit aus dem Netz heraus installiert werden. Das Ergebnis können wir dort wiederum anderen zugänglich machen.
Digitale Kultur ist somit die aktuell triftigste Spielmarke einer alten Utopie geworden: die Schließmechanismen einer in Klassen und Schichten stratifizierten bürgerlichen Gesellschaft aufzulösen und sowohl die Produktion als auch die Rezeption von Kultur zu vergesellschaften. Dies stellt eine keineswegs triviale Intervention in jene bürgerliche Kultur dar, die trotz aller formalen Bekenntnisse zu Demokratie, Gleichheit und Aufklärung doch Jahrhunderte lang sehr unterschiedliche Zugangsvoraussetzungen zu Kultur und ihren Produktionsmitteln hervorgebracht hat und die ihre Subjekte mit ungleichen Handlungsmöglichkeiten, Sprecher_innenpositionen und Spielräumen ausstattet. In der Regel korrespondieren diese mit ihren Klassen-, Geschlechter- sowie ethnischen Positionierungen.
Digitalität ermöglicht dagegen neue und andere kulturelle (und damit: gesellschaftliche) Beziehungen, die nicht mehr zwangsläufig an bestimmte Privilegien und die Verfügungsgewalt über kulturelle Produktionsmittel (im alten Sinne) gebunden sein müssen. Neue Formen von Partizipation und Inklusion sind dabei entstanden, die Kollektivität da stiften, wo zuvor nur der rigide Konkurrenzkampf aller gegen alle am Werke war. In ihnen können wir unser digitales Zusammenleben offen und gemeinsam entwickeln (mit Rückwirkung auch auf seine analogen Formen). Dies war zuvor meist Einzelnen vorbehalten – seien es nun Wirtschaftsunternehmen (im Bereich der Technologieentwicklung) oder Künstler_innen (im Bereich der Kultur).
Nicht-profitorientierte Formen des (Aus-)Tauschs, wie sie die Netzkultur etabliert hat, wären als wichtige Erfahrungswerte und Modellsituationen für eine allgemeine und generelle Veränderung zu begreifen, statt sie nur in den Zusammenhang unseres individuellen Wunsches nach Zugriff auf möglichst umfassende Datenbänke zu stellen. Sie dürfen jedenfalls nicht blockiert werden, nur weil sie mit den Sonderinteressen Einzelner konfligieren.
Die digitale Kultur, die wir durch unsere Arbeit hervorbringen, muss also im Bewusstsein handeln, dass sie, was sie macht, nicht für sich selbst und die eigene Szene tut, sondern für alle. Die gesellschaftlichen Beziehungen, die sie dabei entwirft, sind durchaus verallgemeinerbar.
Günther Friesinger ist Medienkünstler, Autor, Kurator und Produzent. Er ist Geschäftsführer des Künstler:innen Kollektives monochrom, Gründer und Leiter von paraflows – Plattform für Digitale Kunst und Kulturen in Wien, der Kulturiniative KOMM.ST in Anger/Weiz und Chairman des Quartier für Digitale Kunst und Kultur im Museumsquartier, Wien. Friesinger lehrt Kunst, Kulturmanagement, Produktion, Social Media und Ausstellungsdramaturgie an verschiedenen Universitäten in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Schwerpunkte der letzten Jahre sind kulturelle Regionalentwicklung, Leerstandsaktivierung und Glücksforschung. Aktuelle Filme: Hacking at Leaves (2023), Razzennest (2022), Transformiert Euch! (2022). Aktuelle Publikationen: Protestformen. Widerstand als kulturelle Praxis (2023), Neue Kunst an alten Orten: 10 Jahre KOMM.ST als kulturelle Nahversorgung (2021), Subvert Subversion: Politischer Widerstand als Kulturelle Praxis (2020), End/Zeit: Das Apokalyptische zwischen Politik, Prognose und Technologie (2018). Tag- Cloud: Zeitgenössische Kunst, Digitale Kultur, Aktivismus, Performance, Medientheorie, Science Fiction, Open Culture, Urban Hacking.